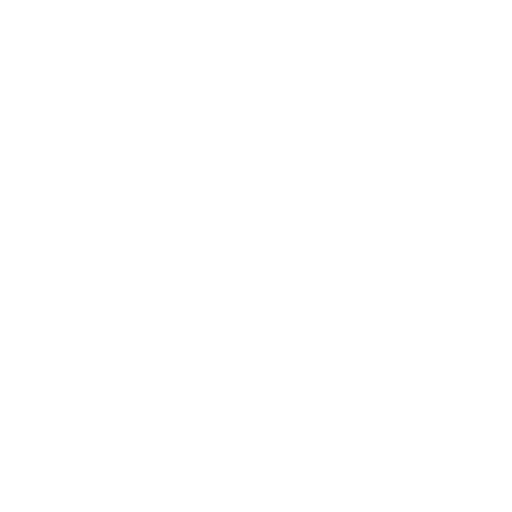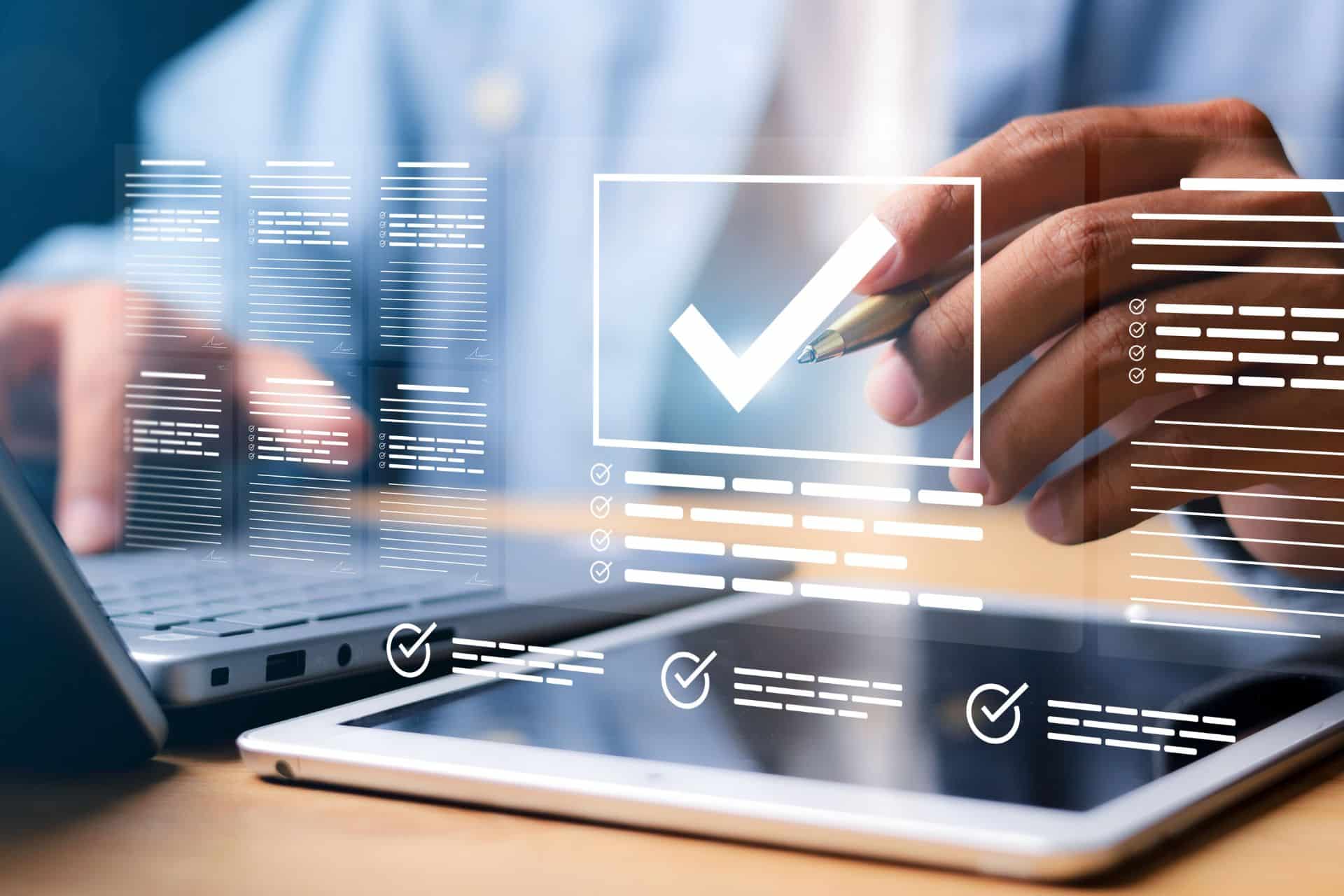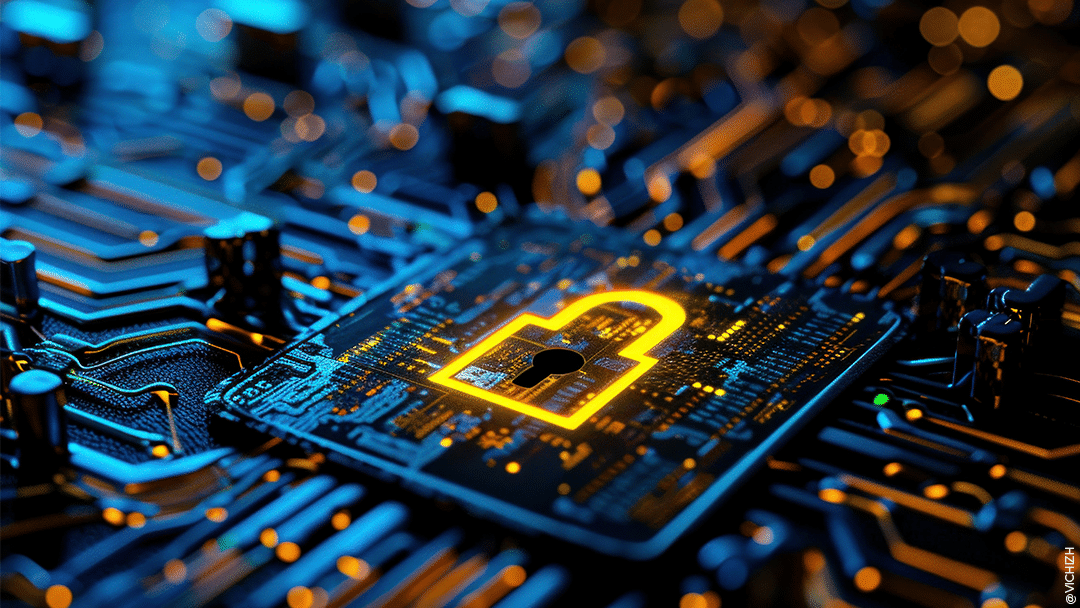Lancer un projet informatique, qu’il s’agisse de développer un logiciel métier, de concevoir une application web, de déployer une infrastructure cloud ou de renforcer la cybersécurité, suppose une vision claire et partagée. Mais comment garantir que toutes les parties prenantes – métiers, DSI, maîtrise d’ouvrage, prestataires – avancent dans la même direction ? La réponse tient dans un document unique : le cahier des charges informatique. Véritable colonne vertébrale d’un projet IT, il formalise les besoins, fixe les attentes et encadre le budget, les délais et la sécurité. Rédiger un cahier des charges pour un projet informatique permet de transformer une vision en plan d’action structuré, mesurable et conforme aux exigences réglementaires. Bien conçu, il maximise les chances de réussite et garantit la cohérence entre stratégie et exécution.
Was ist ein Lastenheft und wozu dient es in der IT?
Le cahier des charges IT est un document de référence qui structure un projet. Il précise les objectifs, détaille les besoins fonctionnels, décrit les contraintes techniques et établit le budget.
Im digitalen Sektor stellt es einen echten strategischen Rahmen dar. Ein IT-Projekt mobilisiert mehrere Fachgebiete: Anwendungsentwicklung, Infrastruktur, Datenmanagement, Cybersicherheit, Cloud, ERP oder CRM. Das Lastenheft stellt die Kohärenz zwischen diesen verschiedenen Akteuren sicher, indem es eine gemeinsame Vision festlegt.
Er spielt mehrere wichtige Rollen:
- Ein Werkzeug für die interne Kommunikation zwischen der Direktion für Informationssysteme (DSI), den Fachbereichen und der Bauherrschaft,
- Strukturierte Definition des Kundenbedarfs in klare und umsetzbare Anforderungen,
- Ausrichtung der Interessengruppen auf die Bedürfnisse, Prioritäten und Ziele.
- Vertragsgrundlage für Dienstleister
- Unterstützung bei der Steuerung während des gesamten Lebenszyklus des Projekts,
- Bezugnahme auf die Einhaltung gesetzlicher und normativer Anforderungen.
In der Praxis verwandelt das IT-Lastenheft eine Idee in ein strukturiertes, messbares und kontrollierbares Projekt.
Die Schlüsselelemente einer guten IT-Spezifikation
Ein effizientes Lastenheft basiert auf einer klaren und umfassenden Struktur. Jeder Abschnitt sollte einen entscheidenden Aspekt des IT-Projekts abdecken, sei es die Einführung eines ERP-Systems, die Implementierung einer SaaS-Lösung, die Entwicklung einer mobilen Anwendung oder die Sicherung einer Cloud-Infrastruktur.
Zu den unverzichtbaren Elementen gehören:
- Der Kontext und die Ziele des Projekts
- Funktionaler Umfang und Ausschlüsse,
- Die geschäftlichen Anforderungen, die in Funktionalitäten umgesetzt werden
- Technische Einschränkungen und Cybersicherheit,
- Anforderungen in Bezug auf externe Schnittstellen, falls zutreffend,
- Lieferumfang und Meilensteine
- Detailliertes Budget.
Diese Komponenten bilden die Grundlage, auf der die Anbieter, Softwarehersteller oder Integratoren (ERP, CRM, Cloud-Lösungen), sich stützen werden, um angepasste und vergleichbare Antworten zu bieten.

Hintergrund und Ziele des Projekts
Der Kontextteil beschreibt das IT-Umfeld, in dem das Projekt angesiedelt ist: vorhandene Geschäftsanwendungen, bereits vorhandene Infrastruktur (Server, Cloud, Netzwerk), aufgetretene Schwierigkeiten (Datensilos, mangelnde Interoperabilität, Bedarf an verstärkter Cybersicherheit) und strategische Herausforderungen der IT-Abteilung. Diese Perspektive hilft den IT-Dienstleistern, die Ausgangssituation zu verstehen und relevante Lösungen vorzuschlagen.
Der Abschnitt über den Kontext beschreibt die IT-Umgebung des Projekts. Es werden die bestehenden Geschäftsanwendungen, die vorhandene Infrastruktur (Server, Cloud, Netzwerk) und die wichtigsten zu lösenden Probleme wie Datensilos, mangelnde Interoperabilität oder die Notwendigkeit, die Cybersicherheit zu erhöhen, aufgeführt.
Dazu kommt der geschäftliche Kontext, der die aktuellen Prozesse, die Irritationen der Nutzer, die organisatorischen Einschränkungen und die geschäftlichen Herausforderungen beleuchtet.
Der Umfang des Projekts muss ebenfalls genau definiert werden, wobei die eingeschlossenen und ausgeschlossenen Elemente klar angegeben werden müssen, um jegliche Mehrdeutigkeit auszuschließen.
Schließlich nimmt die Beschreibung der Endnutzer einen zentralen Platz ein. Ihre Profile, Erwartungen und Bedürfnisse sind für die funktionalen und technischen Entscheidungen direkt relevant.
Die Ziele spiegeln dann die Ambitionen des digitalen Projekts wider. Sie können Folgendes betreffen:
- Operative Effizienz: Automatisierung von Geschäftsprozessen, Optimierung des Datenflusses, Reduzierung manueller Aufgaben mithilfe von Tools zur Zusammenarbeit,
- Wachstum: Einführung eines ERP-Systems für mehrere Länder, Integration neuer Tochtergesellschaften, Expansion über digitale Kanäle (E-Commerce, Webanwendung, mobile Anwendung),
- Compliance: Einhaltung der DSGVO, Integration von ISO 27001 Standards, Feinsteuerung des Benutzerzugriffs,
- Transformation: Migration in die Cloud, Einführung von SaaS-Lösungen, Modernisierung der Datenarchitektur oder Integration innovativer Technologien wie künstliche Intelligenz.
Erwartete Funktionen
Das IT-Pflichtenheft präzisiert die erwarteten Funktionen und übersetzt sie in operative und technische Anforderungen. Dieser Schritt stellt sicher, dass die gewählte Lösung den geschäftlichen Anforderungen entspricht und sich gleichzeitig gut in das Ökosystem der IT-Abteilung einfügt.
Um diese Funktionen zu organisieren, ist die Priorisierung von entscheidender Bedeutung. Die MoSCoW-Methode wird häufig verwendet:
- Must have: unverzichtbare Funktionen, die direkt mit den strategischen Zielen des Projekts verbunden sind,
- Should have: Funktionen, die wichtig, aber nicht entscheidend für die unmittelbare Erzielung von Ergebnissen sind,
- Could have: Optionale Funktionen, die einen Mehrwert darstellen, wenn die Ressourcen und der Zeitrahmen dies zulassen,
- Won’t have: Funktionen, die nicht im aktuellen Umfang enthalten sind, aber zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht gezogen werden können.
Diese Priorisierung verbindet jede Anforderung mit den Geschäftszielen und ermöglicht es, zu identifizieren, was tatsächlich zum Erfolg des Projekts beiträgt.
In dieser Logik ist das Konzept des MVP (Minimum Viable Product) von entscheidender Bedeutung: Es besteht darin, eine erste Version zu definieren, die sich auf die wesentlichen Funktionen konzentriert, das Produkt schnell in Betrieb zu nehmen, seine Annahme zu testen und es schrittweise zu verbessern.
Der funktionale Umfang hängt von der Art des IT-Projekts ab:
- Webanwendung: Verwaltung von Benutzern, Rollen und Zugriffsrechten, Anpassung der Bereiche und Funktionen für die Zusammenarbeit,
- Mobile Anwendung: mobile-first Ergonomie, iOS/Android-Kompatibilität, Verwaltung von Benachrichtigungen,
- ERP: Multi-Entity-Management, Integration mit anderen Business-Tools, erweitertes Berichtswesen,
- CRM: Kundenbeziehung, Marketing-Automatisierung, Personalisierung der Wege,
- Branchensoftware: Interoperabilität, evolutionäre Wartung, Nachhaltigkeit der Entwicklungen.
Technische Einschränkungen, Sicherheit, Kompatibilität
Die technischen und sicherheitsrelevanten Einschränkungen beschreiben die Umgebung, in die die Lösung integriert werden muss, sowie die Verpflichtungen, die erfüllt werden müssen.
Dieser Abschnitt einer IT-Spezifikation umfasst in der Regel:
- Interoperabilität: Kompatibilität mit bereits eingesetzter Software (ERP, CRM, Datenbanken), Einhaltung offener Standards und Verfügbarkeit von APIs zur Erleichterung der Integration.
- Cybersicherheit: Das Dokument muss die Anforderungen an Verschlüsselung, Zugriffsmanagement und starke Authentifizierung (MFA) spezifizieren. In einem Pflichtenheft für die Cybersicherheit liegt der Schwerpunkt auf der Erkennung von Bedrohungen, dem Schutz sensibler Daten und der Geschäftskontinuität.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Referenzstandards wie die DSGVO und ISO 27001 müssen in das Lastenheft aufgenommen werden, um die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen zu gewährleisten.
- Cloud und Infrastruktur: Wenn es sich um eine Migration oder eine neue Implementierung handelt, definiert ein Cloud-Pflichtenheft die Erwartungen in Bezug auf Verfügbarkeit (SLA), Fehlertoleranz, Skalierbarkeit und Latenzmanagement.
- Leistung und Zuverlässigkeit: Anforderungen in Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit, die Größe der Architektur und die Fähigkeit zur zukünftigen Entwicklung.
- Wartbarkeit: Leichte Aktualisierbarkeit , Skalierbarkeit des Codes, klare Dokumentation und die Fähigkeit, neue Funktionen zu integrieren, ohne das Bestehende zu destabilisieren.
Ein gut erstelltes technisches Lastenheft antizipiert kritische Punkte, die das Projekt gefährden könnten, und sichert die Integration der Lösung in das bestehende Ökosystem.
Ergebnisse, Meilensteine, Planung
Ein IT-Projekt ist um Schlüsseletappen herum strukturiert, die seine Verständlichkeit und seinen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Das Lastenheft legt diese Eckpunkte fest, um den Teams und Dienstleistern einen klaren Fahrplan zu geben.
- Die Liefergegenstände umfassen alle Elemente, die im Laufe des Projekts produziert werden: Entwurfsdokumente, Anwendungsprototypen, Testberichte, Zwischenversionen und Endversionen. Sie stellen den Fortschritt dar und dienen als Grundlage für die Validierung durch die Fachbereiche oder die IT-Abteilung.
- Meilensteine sind die Schlüsselmomente des Projekts: Validierung des funktionalen Designs, technische Abnahme, Produktionsstart. Sie markieren das Ende eines Schrittes und sind Voraussetzung für den Beginn des nächsten Schrittes.
- Der Zeitplan organisiert die Abfolge der Etappen: Entwurf, Entwicklung, Integration, Einsatz. Dieser detaillierte Zeitplan sorgt für Transparenz und erleichtert die Koordination zwischen den Fachbereichen, den Auftraggebern und den IT-Dienstleistern.
Vorläufiger Haushalt
Das Budget ist ein entscheidendes Element des IT-Lastenhefts. Es dient als direkte Orientierung für die Angebote der Dienstleister und bestimmt die Durchführbarkeit des Projekts. Eine klare und realistische Schätzung erleichtert den Vergleich von Angeboten bei einer IT-Ausschreibung und vermeidet unangenehme Überraschungen während des Projektverlaufs.
Es gibt mehrere Ansätze:
- Gesamtbetrag: Ein einziges Budget, das für das gesamte Projekt festgelegt wird,
- Indikative Bandbreite: Ein geschätzter Rahmen, der Spielraum für Anpassungen lässt,
- Aufschlüsselung nach Posten: Eine detaillierte Aufschlüsselung, die die Kosten für Entwicklung, Softwarelizenzen, Infrastruktur (Cloud, Server), Schulung und Wartung umfasst.
Dies gilt insbesondere für strategische Projekte wie die Migration in die Cloud, die Einführung eines ERP-Systems oder die Einführung einer SaaS-Lösung.
Ein gut durchdachtes Budget umfasst sowohl die unmittelbaren Ausgaben als auch die Vorwegnahme der Kosten für Wartung, Skalierbarkeit und zukünftige Sicherheitsanforderungen oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (RGPD, ISO 27001).

Wie erstellt man eine klare und nützliche Spezifikation?
Die Erstellung eines IT-Pflichtenhefts ist eine gemeinschaftliche Übung , die mehrere Beteiligte einbezieht. Die Geschäftsbereiche äußern ihre Erwartungen, die IT-Abteilung bringt ihr technisches Fachwissen ein und der Auftraggeber sorgt für die Gesamtkohärenz des Projekts. In einigen Fällen vervollständigt ein externer Partner wie ein NSP oder ein Beratungsunternehmen die Analyse. Um das Projekt nutzbar zu machen, sind zwei Dimensionen wichtig: die Anwendung guter Praktiken und die Vermeidung häufiger Fehler.
Gute Praktiken
Ein effektives IT-Pflichtenheft hängt sowohl von seinem Inhalt als auch von der Art und Weise ab, wie es verfasst wird. Um die Qualität und Klarheit zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Sie:
- Die Interessengruppen bereits in der Vorbereitungsphase einbeziehen,
- Eine klare, für alle verständliche Spracheverwenden
- Das Dokument in einer einheitlichen und lesbaren Weise zu organisieren,
- Prioritäten setzen, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen,
- Eine Komponente für Wartung und Skalierbarkeit integrieren.
Mit dieser Methode wird das Lastenheft zu einem echten Steuerungsinstrument und einer Referenz, die von allen Projektbeteiligten geteilt wird.
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten
Einige Fehler schwächen den Wert einer IT-Spezifikation und erschweren den Projektverlauf:
- Zu vage Ziele, die zu unterschiedlichen Interpretationen führen,
- Unrealistische Fristen, die zu Spannungen zwischen den Geschäftsbereichen und den Dienstleistern führen,
- Keine Hierarchisierung der Bedürfnisse, was einen Vergleich zwischen mehreren Antworten erschwert,
- Unzureichende Cybersicherheit, mit Risiken für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Datenschutz,
- Nicht-Einbeziehung der Endnutzer, was zu einer Diskrepanz zwischen der gelieferten Lösung und der tatsächlichen Nutzung führt.
Qim info unterstützt Sie bei der Erstellung eines Lastenhefts für Ihre IT-Projekte.
Die Erstellung eines klaren und operationellen IT-Pflichtenhefts erfordert Zeit, Erfahrung und eine globale Vision der Herausforderungen. Qim info unterstützt Organisationen bei diesem Prozess, um ihre Ideen in strukturierte und realistische IT-Projekte umzusetzen.
Unsere Business Analysten und Berater greifen bereits in der Vorbereitungsphase ein, um:
- Organisation eines gemeinsamen Rahmens mit den Fachbereichen, der IT-Abteilung und dem Auftraggeber,
- Die Fachbereiche bei der Formulierung und Priorisierung ihrer Bedürfnisse zu unterstützen,
- Ein vollständiges und homogenes Lastenheftdokument zu strukturieren,
- Ausgewogene Auswahlkriterien für den Vergleich der Angebote festlegen,
- Integration von Cybersicherheits-, Compliance- (DSGVO, ISO 27001) und Leistungsanforderungen,
- Die Wartung und Skalierbarkeit antizipieren.
Dank seiner transversalen Expertise in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, Anwendungsentwicklung, ERP, CRM und SaaS-Lösungen bietet Qim info einen pragmatischen und maßgeschneiderten Ansatz. Jedes Projekt profitiert von einer Begleitung, die auf die Realität der Organisation und ihre strategischen Ambitionen zugeschnitten ist.
Kontaktieren Sie uns, um sich mit einem Qim Info-Experten auszutauschen und Ihre IT-Projekte zum Leben zu erwecken.
Lesen Sie auch unseren Artikel: Ausschreibung: Unsere Tipps für Ihre IT-Projekte.
FAQ zur Spezifikation
Funktionales vs. technisches Lastenheft: Was ist der Unterschied?
Bei einem IT-Projekt werden zwei komplementäre Lastenhefte unterschieden: das funktionale, das beschreibt, was erreicht werden soll, und das technische, das festlegt, wie es umgesetzt werden soll.
Das funktionale Lastenheft richtet sich an die Fachbereiche und beschreibt die erwartete Nutzung, die Benutzerwege und die Ziele. Es enthält insbesondere
- Geschäftsprozesse,
- Die funktionalen Bedürfnisse,
- Die Verwaltungsregeln,
- Die erwarteten Interaktionen zwischen Nutzern und System.
Das technische Lastenheft setzt diese Erwartungen in konkrete Spezifikationen um. Es präzisiert:
- Die Architektur des Systems,
- Infrastrukturentscheidungen,
- Sicherheitsstandards,
- Die Integration mit dem Vorhandenen,
- Die erwarteten Leistungen.
Braucht man ein Lastenheft für ein agiles Projekt?
Auch ein agiles Projekt erfordert einen anfänglichen Rahmen. Das Lastenheft legt die Grundlagen fest, lässt aber die nötige Flexibilität für iterative Anpassungen.
Er kann definieren:
- Die wichtigsten Geschäftsziele,
- Die Priorisierung von Funktionen,
- Regulatorische Beschränkungen,
- Die vorgeschriebenen Technologien,
- Das Gesamtbudget.
Die funktionalen Details werden dann schrittweise mit dem Fortschritt des Projekts präzisiert.
Kann man ihn selbst ohne Dienstleister verfassen?
Ein Unternehmen kann sein Lastenheft intern erstellen, insbesondere bei Projekten von begrenztem Umfang. Bei komplexen Projekten ist dieser Ansatz jedoch riskant, da einige Aspekte oft unterschätzt werden.
Ein intern erstelltes Dokument kann Folgendes umfassen
- Die geschäftlichen Anforderungen,
- Die grundlegenden technischen Beschränkungen,
- Die organisatorischen Regeln.
Ein externer Experte verstärkt das Dokument, indem er:
- Eine strukturierte Methodik,
- Einen objektiven Blick,
- Erfahrungsberichte aus anderen Projekten,
- Eine bessere Kontrolle der Fristen und somit eine Zeitersparnis durch die Einbeziehung von Anfang an.
Wer erstellt eine Spezifikation?
Die Verantwortung für die Redaktion variiert je nach Organisation.
- ISD: steuert und formalisiert das Dokument mit den Fachbereichen,
- Business analyst : aide à exprimer et prioriser les besoins, puis les traduit en exigences exploitables,
- Chef de projet transverse : coordonne les contributions,
- Einkaufsabteilung: gewährleistet Konformität und Standardisierung,
- Externer Berater oder ESN: bringt Fachwissen, Methoden und Neutralität ein.
Die Erstellung erfolgt fast immer in Gemeinschaftsarbeit, an der auch die Endnutzer beteiligt sind.
Kann eine Spezifikation während des Projekts geändert werden?
Ein Lastenheft kann sich aufgrund von Rückmeldungen oder neuen Einschränkungen ändern. Diese Entwicklungen müssen überwacht werden, um ein kohärentes Projekt zu erhalten.
Sie betreffen in der Regel:
- Funktionelle Anpassungen,
- Technische Änderungen vorbehalten,
- Planungsrevisionen.
Jede Entwicklung muss:
- Formalisiert,
- Validiert,
- Mit allen Interessengruppen geteilt.